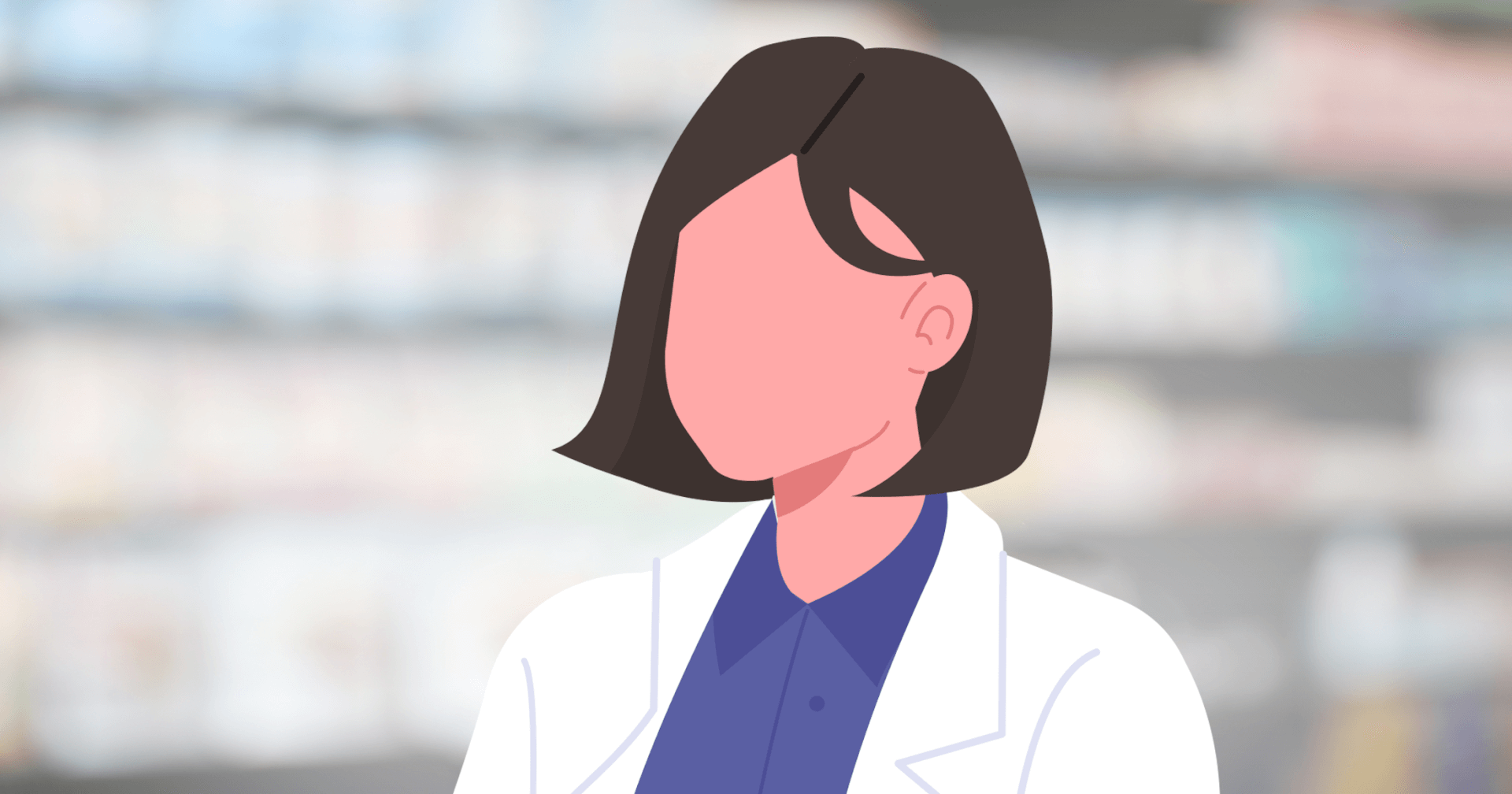Die „Abnehmspritzen“: Was steckt hinter dem Hype?
Geschrieben von Eva Moser am 18. März 2025

Ursprünglich im Speichel der nordamerikanischen Krustenechse entdeckt, sorgen die GLP-1-Rezeptoragonisten oder Inkretin-Mimetika als “Fett-Weg-Spritze” für Furore. Warum erregen diese Medikamente derzeit so viel Aufmerksamkeit?

Übergewicht und Typ-2 Diabetes: ein verhängnisvolles Team
Die GLP-1-Rezeptoragonisten haben die Therapie des Typ-2 Diabetes und eines übermässigen Körpergewichtes grundlegend verändert. Richtig angewendet lohnt sich jedoch die mit einigem Aufwand verbundene Medikation für die Betroffenen.
Als übergewichtig gelten Personen mit einem Body-Mass-Index (BMI, Körpergewicht in Kilo, geteilt durch die Körpergrösse in Meter zum Quadrat) von 25,0 bis 29,9 kg/m², Personen mit einem BMI > 30 kg/m² leiden unter starkem Übergewicht (Adipositas).
Übergewicht und Adipositas, komplexe Erkrankungen mit genetischen, hormonellen und psychologischen Ursachen, entstehen durch ein Ungleichgewicht von Energieaufnahme und -verbrauch. Entgegen früheren Annahmen gelten sie nicht als Folge von Willensschwäche, sondern sind wissenschaftlich anerkannte Krankheiten. Die WHO sieht Adipositas als globales, chronisches Gesundheits-problem, das weltweit zunimmt. In Europa ist bereits jedes dritte 11-jährige Kind betroffen. Folgeerkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Typ-2-Diabetes nehmen dramatisch zu.
Bauchfett unerwünscht
Bei übergewichtigen und adipösen Personen entsteht durch Vermehrung des Bauchfettes (viszerales Fett) und des Fettgewebes der Leber als Folge einer Immunreaktion hoch entzündliches, metabolisch aktives Gewebe, das im Körper zahlreiche Botenstoffe (chemische Informationsübermittler im Körper, z.B. Hormone) freisetzt, die u.a. den Fett- und Zuckerstoffwechsel, das Hunger- und Sättigungsgefühl sowie Entzündungsprozesse beeinflussen. Dies führt letztendlich zu einer Unempfindlichkeit gegenüber Insulin, der sogenannten Insulinresistenz. Ausserdem kommt es u.a. zu einer ungünstigen Veränderung der Blutfettwerte. Die Folgen sind vielfältig: Fettstoffwechselstörungen, Arteriosklerose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes Typ-2, Gelenkbeschwerden, Krebserkrankungen, Belastungsinkontinenz, psychische Erkrankungen und viele mehr.

Weshalb nehmen Menschen mit Übergewicht mehr Nahrung zu sich als schlanke Personen?
Verschiedene Faktoren begünstigen eine erhöhte Nahrungsaufnahme bei bestimmten Individuen:
Genetische Modifikation
Veränderungen die das Hormon Leptin betreffen. Es ist an der Kontrolle der Nahrungsaufnahme beteiligt und verhindert, dass wir zu viel essen.
Appetitregulation
Die Regulation des Essverhaltens findet im Gehirn statt (Hypothalamus): Dort beeinflusst Leptin, das aus dem Fettgewebe ins Gehirn gelangt, die Empfindlichkeit der Nervenzellen für Sättigungssignale. Bei übergewichtigen Personen kommt es zu entzündlichen Veränderungen in der zuständigen Hirnregion, was zu einer Fehlfunktion der appetitregulierenden Nervenzellen und dadurch zu einem gestörten Sättigungsgefühl führt.
Hormone
Direkt nach der Nahrungsaufnahme im Magen produzierte Hormone melden dem Gehirn Informationen über Nahrungsgehalt und-menge. Die Prozesse der sogenannten Darm-Hirn-Achse sind bei übergewichtigen Personen gestört.
Diese ungünstigen Voraussetzungen werden durch unsere heutige Lebensweise, die durch einen Überfluss an Nahrung und ein Mangel an täglicher Bewegung gekennzeichnet ist, verschärft.

Insulin und Inkretine: Partner für einen gesunden Blutzuckerspiegel
Insulin zählt zu den wichtigsten Hormonen der Bauchspeicheldrüse zur Regulation des Blutzuckers. Es ist dafür verantwortlich, dass der durch die Nahrung aufgenommene Zucker aus dem Blut in die Zellen aufgenommen wird und für die Energiegewinnung genutzt werden kann. Daneben beeinflussen die im Darm gebildeten Inkretine GLP-1 (Glucagon-like peptide 1) und GIP (Gastric inhibitory peptide) die Blutzuckerwerte. Sie werden bei Nahrungsaufnahme abgegeben und regen die Ausschüttung von Insulin aus den β-Zellen der Bauchspeicheldrüse an (Inkretin-Effekt). GLP-1 wird bei Typ-2 Diabetikern nur vermindert abgegeben. Rezeptoren für GLP-1 finden sich ausser im Darm beispielsweise in Muskulatur, Leber und Fettgewebe, im Magen, in der Bauchspeicheldrüse sowie im Gehirn (Hypothalamus), was die folgenden Effekte der Inkretine erklärt:
-
Hemmung der Ausschüttung des blutzuckersteigernden Hormons Glukagon
-
Steigerung des blutzuckersenkenden Hormons Insulin
-
Verminderung des Hungergefühls sowie Verzögerung der Magenentleerung, dadurch kommt es zur Gewichtsabnahme
-
Schützende Wirkung auf Herz und Nieren
GLP-1 Rezeptoragonisten: Neue Hoffnung für Personen mit Typ-2 Diabetes und Übergewicht
Die Therapie der Adipositas setzt sich zusammen aus der Basistherapie, bestehend aus Ernährungs-, Bewegungs- und Verhaltenstherapie, sowie der medikamentösen Therapie. Ähnlich verhält es sich bei Typ-2 Diabetes. Auch hier stehen an erster Stelle die Gewichtsreduktion und erhöhte körperliche Aktivität. Erst wenn dies nicht zum gewünschten Erfolg führt, werden verschiedene Medikamentenkombinationen eingesetzt. Inkretine sind besonders für Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder einem Risiko dafür geeignet. Die zur Behandlung des Typ-2-Diabetes entwickelten GLP-1- und GIP/GLP-1-Rezeptoragonisten (Agonist = Wirkstoff, der einen bestimmten Botenstoff in seiner Wirkung imitiert) haben in klinischen Studien gezeigt, dass sie auch zur Gewichtsreduktion bei Adipositas geeignet sind.
Diabetes-Therapie: Die Evolution der GLP-1-Wirkstoffe
Der erste GLP-1-Rezeptoragonist Exenatid (Byetta®) wurde in den USA bereits 2005 in Kombination mit anderen Antidiabetika zugelassen. Exenatid ist synthetisch hergestellt und analog dem Exendin 4 aufgebaut, das im Speichel der nordamerikanischen Krustenechse entdeckt wurde. Exendin-4 wird jedoch schnell im Körper abgebaut und ist somit therapeutisch ungeeignet. Daher wurden Wirkstoffe entwickelt, die durch strukturelle Veränderungen deutlich langsamer abgebaut werden und zum Teil nur 1-mal wöchentlich angewendet werden müssen.

Die Qual der Wahl
Die Produkte unterscheiden sich in ihrem Einsatzgebiet, der Anwendungshäufigkeit und Anwendungsweise. Die Präparate liegen in verschiedenen Stärken vor. Für eine gute Verträglichkeit ist es wichtig, mit der niedrigsten Stärke zu beginnen und dann langsam, in der Regel nach 4 Wochen, zu steigern. Für eine Vergütung durch die Krankenkasse muss mindestens ein BMI von 28 vorliegen. In der Schweiz sind derzeit folgende GLP-1- bzw. GIP/GLP-1-Rezeptoragonisten im Handel:
Ozempic® (Semaglutid)
Behandlung eines unzureichend kontrollierten Typ-2 Diabetes ergänzend zu Diät und Bewegung, subkutane Injektion 1-mal pro Woche
Vergütung durch die Krankenkasse: max. 1 mg pro Woche.
Patienteninfo: Ozempic® (Semaglutid)
Rybelsus® (Semaglutid)
Behandlung Erwachsener mit unzureichend kontrolliertem Typ-2 Diabetes ergänzend zu Diät und Bewegung, einziges Präparat in Tablettenform, tägliche Einnahme.
Patienteninfo: Rybelsus® (Semaglutid)
Download PDF: Rybelsus Kurzinfo Patienten
Wegovy® (Semaglutid)
Ergänzung zu einer kalorienreduzierten Ernährung und verstärkter körperlicher Aktivität zur Gewichtsregulierung bei einem BMI ≥30 kg/m2 oder ≥27 kg/m2 bis < 30 kg/m2 bei Vorliegen mindestens einer gewichtsbedingten Begleiterkrankung (z.B. Bluthochdruck, Diabetes, Fettstoffwechselstörung), subkutane Injektion 1-mal pro Woche
Die zu erwartende Gewichtsreduktion beträgt ca. 15,8 %. Die Behandlung bedarf der Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation eines Facharztes und ist an eine Diät bzw. bestimmte Gewichtsreduktion gebunden.
Patienteninfo: Wegovy® (Semaglutid)
Victoza® (Liraglutid)
Behandlung eines unzureichend kontrollierten Typ-2 Diabetes ergänzend zu Diät und Bewegung, subkutane Injektion 1-mal pro Tag.
Patienteninfo: Victoza® (Liraglutid)
Saxenda® (Liraglutid)
Ergänzung zu einer kalorienreduzierten Ernährung und verstärkter körperlicher Aktivität zur Gewichtsregulierung bei einem BMI ≥30 kg/m2 oder ≥27 kg/m2 bis < 30 kg/m2 bei Vorliegen mindestens einer gewichtsbedingten Begleiterkrankung, subkutane Injektion 1-mal pro Tag. Die zu erwartende Gewichtsreduktion beträgt ca. 6,4 %
Die Behandlung bedarf der Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation eines Facharztes und ist an eine Diät bzw. bestimmte Gewichtsreduktion gebunden.
Patienteninfo: Saxenda® (Liraglutid)
Trulicity® (Dulaglutid)
Behandlung eines unzureichend kontrollierten Typ-2 Diabetes ergänzend zu Diät und Bewegung, subkutane Injektion 1-mal pro Woche.
Patienteninfo: Trulicity® (Dulaglutid)
Bydureon BCise Depot® (Exenatid)
Behandlung des Typ-2 Diabetes in Kombination mit anderen Medikamenten gegen Diabetes, subkutane Injektion 1-mal pro Woche.
Patienteninfo: Bydureon BCise Depot® (Exenatid)
Mounjaro® (Tirezepatid)
Behandlung eines unzureichend kontrollierten Typ-2 Diabetes ergänzend zu Diät und Bewegung und zur Ergänzung zu einer kalorienreduzierten Ernährung und verstärkter körperlicher Aktivität zur Gewichtsregulierung bei einem BMI ≥30 kg/m2 oder ≥27 kg/m2 bis < 30 kg/m2 bei Vorliegen mindestens einer gewichtsbedingten Begleiterkrankung, subkutane Injektion 1-mal pro Woche
Der Wirkstoff von Mounjaro® greift am GIP und GLP-1-Rezeptor an, die Gewichtsreduktion beträgt bis zu 21 %. Das Präparat ist jedoch nicht in der Spezialitätenliste aufgeführt und wird von der Krankenkasse nur bei Vorliegen einer Kostengutsprache erstattet.
Patienteninfo: Mounjaro® (Tirezepatid)
Keine Wirkung – ohne Nebenwirkungen
Folgende Nebenwirkungen können bei der Anwendung von GLP-1- bzw. GIP/GLP-1-Rezeptoragonisten auftreten:
- Reaktionen an der Injektionsstelle
- Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Verstopfung, Durchfall. Diese Nebenwirkungen können durch eine langsame Steigerung der Dosis vermieden oder minimiert werden.
- Kopfschmerzen, Schwindel, Schlaflosigkeit
- Gallensteine
- Unterzucker bei zusätzlicher Behandlung mit Insulin oder SGLT-2 Inhibitoren (z.B. Jardiance®, Forxiga®)
- Akute Bauchspeicheldrüsenentzündung (plötzlich auftretende gürtelförmige Bauchschmerzen um den Nabel, Ausstrahlung in den Rücken)
- Sehr geringes Risiko für Schilddrüsenkrebs
- Reversibler Haarausfall unter Saxenda®
- Nach Absetzen ist in den meisten Fällen wieder eine Gewichtszunahme zu erwarten
- Abnahme von Muskelmasse, daher ist körperliche Betätigung/Sport wichtig.
GLP-1- bzw. GIP/GLP-1-Rezeptoragonisten sind in Schwangerschaft und Stillzeit kontraindiziert.
Wichtige Hinweise zum Abschluss
Die Forschung zu GLP-1- und GIP/GLP-1-Rezeptoragonisten ist vielversprechend. Da sie neu sind, wird ihr langfristiger Nutzen noch erforscht. In den kommenden Jahren sind vermutlich weitere Substanzen mit zusätzlichen Angriffspunkten im Körper zu erwarten. Da die Wirkstoffgruppe relativ neu ist, wird man erst im Lauf der Jahre ihren tatsächlichen Nutzen abschätzen können. Die Wirkstoffe sollen keinesfalls eine gesunde Lebensweise ersetzen und den Personen vorbehalten bleiben, für die sie medizinisch indiziert sind. Die Liefersituation hat sich in den letzten Wochen entspannt, jedoch muss weiterhin davor gewarnt werden, die Medikamente im Internet zu bestellen. Ein gefälschter Pen kann schlimmstenfalls zum Tode führen.
Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen: Nutzen Sie diesen Beitrag, um informierte Entscheidungen zu treffen. Bleiben Sie aktiv, achten Sie auf Ihr Wohlbefinden und zögern Sie nicht, sich in Baden und Dättwil persönlich beraten zu lassen.
Ihr Apotheke Wyss Team
Literaturnachweis
- Auer-Kletzmayr H, Inkretin-Analoga in der Adipositas- und Typ-2-Diabetes-Therapie, online-academy. 06/2024
- Dingermann T, GLP-1-Agonisten sind Durchbruch des Jahres 2023, Pharmazeutische Zeitung, 12/2023
- Kohler S, Beise U, Huber F, Guideline Diabetes mellitus, medix Schweiz, 09/2023
- Pensler A, Perspektiven der neuen Diabetes-Therapie, Medizinische Monatszeitschrift für Pharmazeuten, 46. Jg., 07/2023
- Frei J, GLP-1 und GIP/GLP-1 RA bei Adipositas, m@il Offizin, 06/2023
- Hinneburg I, GLP-1-Agonisten im Überblick, Medizinische Monatszeitschrift für Pharmazeuten, 36. Jg., 07/2013
Bewerten